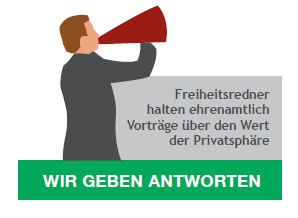Mit dem heutigen Sonntag geht ein Bündnis aus mittlerweile mehr als 90 Gruppen und Initiativen mit einem Appell „Keine Kampfdrohnen!“ an die Öffentlichkeit.
Der Appell beinhaltet zwei konkrete, an Bundestag und Bundesregierung gerichtete Forderungen. Zum einen die Forderung des sofortigen Stopps der Anschaffung, Produktion, Forschung und Entwicklung von und zu bewaffneten oder bewaffnungsfähigen Flugdrohnen. Zum anderen verlangen die unterzeichnenden Menschen und Gruppen dieser „Drohnen-Kampagne“ den Einsatz der Volksvertreter für eine weltweite Ächtung dieser sich stark entwickelnden Waffentechnologie.
Aber der Appelltext enthält eine weitere, wichtige Komponente, auf die ich besonders eingehen möchte.
Weitung der Perspektive, Stärkung der Kräfte
 Der einleitende Satz des Appells lautet:
Der einleitende Satz des Appells lautet:
„Wir sind gegen die Etablierung einer Drohnentechnologie zur Kriegsführung, Überwachung und Unterdrückung.“
Mit dieser Präambel zieht die Kampagne weitere Kreise als nur die zunächst nur von der Friedensbewegung ausgehende Forderung des Banns von Kampfdrohnen. Das ist zugleich richtig wie auch besonders erfreulich – sind ähnliche Ansätze in anderen Ländern nämlich häufig gescheitert.
In Großbritannien beispielsweise konzentriert sich die Kritik des inzwischen relativ berühmten und sehr informativen Portals „Drone Wars UK“ beinahe ausschließlich auf militärisch genutzte Drohnen – eine Zusammenarbeit mit Bürgerrechtsaktivisten, die den vermehrten Einsatz von Überwachungsdrohnen im Inneren kritisiert findet so gut wie nicht statt.
Ähnlich die internationale Kampagne der Human Rights Watch unter dem Namen „Ban ‚Killer Robots‘ Before It’s Too Late“, denn diese beschränkt sich auf automatisierte bzw. autonom handelnde Roboter, was einige Menschen als untragbar empfinden, lässt es aus ihrer Perspektive doch die Interpretation zu, als sei nicht-autonomes Töten von Maschinen, also z.B. Hinrichtungen durch ferngesteuerte Kampfdrohnen ohne Prozess, Verfahren oder Verteidigungsmöglichkeit akzeptabel. (Was wiederum zur nächsten Frage der sich entblätternden Zwiebel führt, ob man denn überhaupt ein absichtliches Töten von Menschen akzeptieren mag oder nicht. Eine Frage?)
Scheinwelten
Eine Trennung zwischen bewaffneten und unbewaffneten Drohnen in sehr vielen Fällen praktisch gar nicht möglich.
Dafür gibt es mehrere Gründe:
1.) Unbewaffnete Drohnen- (und andere) Systeme lassen sich zu bewaffneten umrüsten. Sei es in unorthodoxer Art und Weise, sei es, weil die entsprechenden Systeme modular aufgebaut und für eine Nachrüstung bereits vorgesehen sind. (Daran ist bei dem sich anbahnenden Export von Predator-Drohnen der USA in den Nahen Osten zu denken.) Aus diesem Grunde alle Arten von Drohnen verbieten zu wollen ist genau so unsinnig wie unrealistisch oder wünschenswert. Aber das ständige Nachfragen und Untersuchen, wem die Technik im Einzelfall dient, wer daran verdient und welche Konsequenzen bestimmte Entwicklungen zur Folgen haben könnten, gehören zum Bewertungsprozess notwendigerweise dazu.

Rheinmetall-Drohne KZO der Bundeswehr, CC-BY-SA von Julian H.
2.) Unbewaffnete Drohnen können dazu dienen, die notwendigen Informationen für einen bewaffneten Angriff zu ermitteln, ganz unabhängig davon, ob dieser mittels anderer Drohnen ausgeführt wird oder nicht – sie dienen dann also mittelbar dem Töten. Als ein praktisches Beispiel sei die Kombination der deutschen Bundeswehrdrohne „KZO“ von der Rheinmetall AG mit der Harop-Drohne des israelischen IAI-Konzerns. Bei der Harop-Drohne handelt es sich um eine so genannte „Kamikaze-Drohne“ (dieser Begriff alleine bedarf kritischer Beleuchtung!), über deren Anschaffung in der Bundeswehr spätestens seit 2010 öffentlich diskutiert wird.
Vor allem aber:

Der neue MD4-3000 von der microdrones GmbH, bekannt für seine guten Kontakte zur chinesischen Elite-Polizei
3.) Selbst wenn Drohnen gänzlich ohne Bewaffnung und ohne direkt damit verbundene Tötungsaktionen einhergehen, können sie ebenfalls mittelbar zu Terror, zu allgemeiner Panik, zur Unterdrückung von Freiheitsbewegungen oder ganzer Landstricke bis hin zu Verschleppung und Verschwindenlassen von Oppositionellen oder Kritikern führen. Damit eine pauschalen Ächtung der Drohnentechnologie anzuführen wäre ebenfalls unsinnig – diese hat wie alle anderen Entwicklungen immer zwei Gesichter. Sehenswert dazu der 7minütige Filmbericht zur Studie „Living under Drones“ (hier im englischen Original oder hier in deutscher Übersetzung).
Wie auch immer: Eine breite und öffentliche Debatte auf Sachebene mit einem sich daraus ergebenden gesellschaftlichen Konsens, der diesen Namen auch verdient, hat einer grundsätzlichen Entscheidungsfällung, ob und in welchem Maße man in einer wünschenswerten Form des Zusammenlebens Drohnentechnologie einsetzen und zulassen möchte oder eben nicht, vorauszugehen.
Gesellschaftliche Probleme – Technische Lösungen

Euro-Hawk-Prototyp der Bundeswehr, insgesamt rund 570 Mio. Euro teuer, CC-BY-SA von TKN
Der Einschätzung der Techniksoziologin Jutta Weber zufolge liegt der Ausdehnung der Drohneneinsätze im Äußeren wie im Inneren der Glaube an die Drohne als „Technological Fix“ zugrunde. Die Drohne als Wundermittel zur Lösung gesellschaftlicher oder zwischenstaatlicher Probleme – ein Spiel mit illusionierenden oder euphemistischen Begriffen wie „gezielte Tötung“, „chirurgische Kriegsführung“, „aus- oder vorgelagertes Kriegsgebiete“ und „Kurzintervention“. Jutta Weber spricht von „Technofetischismus“.
Dieses Scheinprinzip zur Reparatur von Sozialsystemen mittels Technik ist „uns“ aus den vielen Diskussionen zur zunehmenden Legitimierung fortschreitender Überwachungsmaßnahmen aus den letzten Jahren nicht neu.
Ich führe das hier nicht weiter aus sondern empfehle stattdessen den Videomitschnitt der einführenden Worte Jutta Webers auf dem Drohnenkongress der „Grünen“ vom 15. März d.J. in Berlin. (Diejenigen „Grünen“, denen ihr pazifistischer Hintergrund ansonsten im allgemeinen abhanden gekommen zu sein scheint und denen ich bei der Haltungsfindung zum Thema Drohnen in dieser Hinsicht einen Sinneswandel wünsche.) Hörenswert im Beitrag von Frau Weber sind auch die Erläuterungen zu praktizierten Drohnentaktiken wie „signature strikes“ und „double-tap strikes“.
Fazit und Ausblick
Die heute gestartete „Drohnen-Kampagne“ hat es geschafft, sich einerseits nicht in unterschiedliche Lager von Friedens- und Bürgerrechtsaktivisten aufspalten zu lassen und sich andererseits nicht auf vereinfachende und unhaltbare Aussagen wie „Wir sind gegen Drohnen“ einzulassen.
Der Appell „Keine Kampfdrohnen!“ ist deswegen ein wertvoller Kernkonsens, weil er bis jetzt zur breiten Mitzeichnung geführt hat (u.a. FIfF, Grundrechtekomitee, RAV, CCC, digitale gesellschaft, digital courage …) und ich wünsche mir, dass die gemeinsame Arbeit der vielen, sehr unterschiedlichen Unterstützergruppen weiter geht und die damit einhergehenden interessanten neuen Vernetzungen zwischen den Menschen viele gute Früchte trägt.
Alle Einzelheiten über den Appell, zur Möglichkeit der Offline- und Online-Zeichnung sowie weitere Informationen zum Thema bietet die sich im ständigen Auf- und Umbau befindliche Kampagnen-Homepage
Dieser Beitrag gibt die persönliche Meinung von Micha wieder und ist kein offizielles Statement des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung.
Bildquellen: Eigene Bilder, CC-BY-SA, ansonsten laut Angabe.